- -> zur Mobil-Ansicht
- Arbeitsrecht aktuell
- Tipps und Tricks
- Handbuch Arbeitsrecht
- Arbeitsrecht - A
- Arbeitsrecht - B
- Arbeitsrecht - C
- Arbeitsrecht - D
- Arbeitsrecht - E
- Arbeitsrecht - F
- Arbeitsrecht - G
- Arbeitsrecht - H
- Arbeitsrecht - I
- Arbeitsrecht - K
- Arbeitsrecht - L
- Arbeitsrecht - M
- Arbeitsrecht - N
- Arbeitsrecht - O
- Arbeitsrecht - P
- Arbeitsrecht - R
- Arbeitsrecht - S
- Arbeitsrecht - T
- Arbeitsrecht - U
- Arbeitsrecht - V
- Arbeitsrecht - W
- Arbeitsrecht - Z
- Gesetze zum Arbeitsrecht
- Urteile zum Arbeitsrecht
- Arbeitsrecht Muster
- Videos
- Impressum-Generator
- Webinare zum Arbeitsrecht
-
Kanzlei Berlin
 030 - 26 39 62 0
030 - 26 39 62 0
 berlin@hensche.de
berlin@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Frankfurt
 069 - 71 03 30 04
069 - 71 03 30 04
 frankfurt@hensche.de
frankfurt@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hamburg
 040 - 69 20 68 04
040 - 69 20 68 04
 hamburg@hensche.de
hamburg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Hannover
 0511 - 89 97 701
0511 - 89 97 701
 hannover@hensche.de
hannover@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Köln
 0221 - 70 90 718
0221 - 70 90 718
 koeln@hensche.de
koeln@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei München
 089 - 21 56 88 63
089 - 21 56 88 63
 muenchen@hensche.de
muenchen@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Nürnberg
 0911 - 95 33 207
0911 - 95 33 207
 nuernberg@hensche.de
nuernberg@hensche.de
AnfahrtDetails -
Kanzlei Stuttgart
 0711 - 47 09 710
0711 - 47 09 710
 stuttgart@hensche.de
stuttgart@hensche.de
AnfahrtDetails
Arbeitsvertrag und allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - Ausschlussklausel
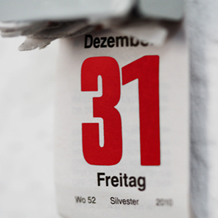
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den Fragen, warum arbeitsvertragliche allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sinnvollerweise Ausschlussfristen enthalten und worauf Arbeitgeber bei der Gestaltung von arbeitsvertraglicher Ausschlussklauseln achten müssen, damit sie mit dem AGB-Recht vereinbar und daher wirksam sind.
Die Regeln, die Arbeitgeber bei der Gestaltung von Ausschlussklauseln einhalten müssen, sind auch für Arbeitnehmer wichtig, denn daraus kann sich ergeben, dass Ansprüche viel länger bestehen als angenommen (falls eine arbeitsvertragliche Ausschlussklausel nämlich unwirksam ist).
von Rechtsanwalt Dr. Martin Hensche, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Berlin
- Was versteht man unter einer arbeitsvertraglichen Ausschlussklausel?
- Wozu dienen arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln?
- Sind arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Arbeitgebers?
- Wann sind arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln überraschend und deshalb unwirksam?
- Wann sind arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln im Sinne des Arbeitnehmers auszulegen?
- Wann sind arbeitsvertragliche Ausschlussfristen zu kurz und die Klausel daher wegen unangemessener Benachteiligung des Arbeitnehmers unwirksam?
- Dürfen arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln die schriftliche Geltendmachung von Ansprüchen vorschreiben?
- Müssen arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln Ansprüche des Arbeitnehmers auf Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns ausdrücklich von ihrem Anwendungsbereich ausnehmen?
- Müssen arbeitsvertragliche Ausschlussfristen Ersatzansprüche wegen vorsätzlicher Schädigung ausdrücklich ausklammern?
- Bleibt die erste Stufe einer Ausschlussfrist bestehen, auch wenn die zweite Stufe unwirksam ist?
- Wo finden Sie mehr zum Thema Arbeitsvertrag und allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - Ausschlussklausel?
- Was können wir für Sie tun?
Was versteht man unter einer arbeitsvertraglichen Ausschlussklausel? 
Aufgrund von Ausschlussfristen verfallen arbeitsvertragliche Ansprüche, d.h. sie gehen endgültig unter, wenn sie nicht innerhalb einer bestimmten Frist nach Fälligkeit geltend gemacht werden.
Ausschlussfristen sind meist kurz. Üblicherweise betragen sie nur zwei, drei oder sechs Monate. Damit sind sie viel kürzer als die gesetzliche Verjährungsfrist von drei Jahren. Anstatt von Ausschlussfrist spricht man auch von Verfallsfrist.
Je nachdem, ob solche Ausschlussfristen in einem Arbeitsvertrag oder z.B. in einem Tarifvertrag geregelt sind, spricht man von
- arbeitsvertraglichen Ausschlussfristen oder
- tarifvertraglichen Ausschlussfristen.
Ausschlussfristen können aber auch in betrieblichen Regelungen wie z.B. in einem Sozialplan enthalten sein. Nähere Informationen zum Thema Ausschlussfristen finden Sie unter Handbuch Arbeitsrecht: Ausschlussfrist.
Eine arbeitsvertragliche Ausschlussklausel ist Regelung, die in einem Arbeitsvertrag enthalten ist und eine Ausschlussfrist anordnet. Eine solche Klausel könnte z.B. lauten:
„Ausschlussfristen, Verfall von Ansprüchen
(1) Alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis, verfallen, d.h. sie gehen endgültig unter, wenn sie nicht binnen drei Monaten nach Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei in Textform geltend gemacht werden.
(2) Lehnt die andere Vertragspartei den Anspruch ab oder erklärt sie sich nicht innerhalb von zwei Wochen nach Geltendmachung des Anspruchs, so verfällt der Anspruch, wenn er nicht binnen drei Monaten nach der Ablehnung oder dem Ablauf der Zweiwochenfrist gerichtlich geltend gemacht wird.
(3) Die in den vorstehenden Absätzen vereinbarten Ausschlussfristen gelten auch für Ansprüche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Zusammenhang stehen.
(4) Die in den vorstehenden Absätzen vereinbarten Ausschlussfristen gelten nicht für Ansprüche aus einer Haftung für vorsätzliche Pflichtverletzungen, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für Ansprüche auf einen Mindestlohn, z.B. nach dem Mindestlohngesetz, oder auf andere nach staatlichem Recht zwingende Mindestarbeitsbedingungen, sowie nicht für sonstige Ansprüche, die kraft Gesetzes der Regelung durch eine Ausschlussfrist entzogen sind.“
Wozu dienen arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln? 
Ausschlussfristen werden in der Rechtsprechung und arbeitsrechtlichen Literatur üblicherweise damit begründet, dass sie dem Rechtsfrieden und der Rechtssicherheit dienen, denn sie führen dazu, dass innerhalb kurzer Zeit Klarheit darüber besteht, welche Ansprüche aus einem Arbeitsverhältnis noch bestehen bzw. eben nicht bestehen.
Im praktischen Ergebnis ihrer Anwendung betreffen Ausschlussfristen fast ausschließlich die Rechtsansprüche von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, vor allem Lohnansprüche. Ausschlussfristen sind daher vor allem für Arbeitgeber vorteilhaft.
Das liegt daran, dass in erster Linie Arbeitnehmer finanzielle Ansprüche gegenüber seinem Vertragspartner haben und nicht umgekehrt. Ansprüche des Arbeitgebers sind nur in Ausnahmefällen betroffen. Das ist z.B. der Fall bei Rückzahlungsansprüchen infolge einer Lohnüberzahlung oder bei Schadensersatzansprüchen.
Sind arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) des Arbeitgebers? 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind gemäß § 305 Abs.1 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB):
- vorformulierte Vertragsbedingungen,
- die für eine Vielzahl von Verträgen ausgearbeitet wurden, und
- die eine Vertragspartei, der AGB-Verwender, der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt.
Diese Definition macht deutlich, dass AGB das „Kleingedruckte“ eines Vertrags sind. In Arbeitsverträgen kommen AGB oft vor, wobei der Arbeitgeber derjenige ist, der die AGB zur Vertragsausgestaltung in seinem Interesse entwirft und dem Arbeitnehmer zur Annahme stellt. Vertragsbestimmungen sind keine AGB, wenn sie individuell ausgehandelt sind, was bei Arbeitsverträgen meist nur bei Hauptleistungspflichten wie z.B. dem Arbeitslohn oder der wöchentlichen Arbeitszeit der Fall ist (wenn überhaupt, da auch Arbeitszeiten und Bezahlung in vielen Fällen einseitig und formularvertraglich vom Arbeitgeber vorgegeben werden). Nähere Informationen dazu finden Sie unter Handbuch Arbeitsrecht: Arbeitsvertrag und allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB).
Arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln sind praktisch immer AGB. Sie betreffen zwar unter anderem auch den Lohnanspruch des Arbeitnehmers und damit eine der Hauptpflichten des Arbeitgebers, aber da sie auch alle anderen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis betreffen, wirken sie nur indirekt auf den Lohnanspruch ein. Vor diesem Hintergrund sind Ausschlussklauseln für Arbeitnehmer so nebensächlich, dass sie praktisch nie über ihre Einzelheiten mit dem Arbeitgeber verhandeln.
Als AGB sind an Ausschlussklauseln insbesondere folgende Anforderungen zu stellen:
- Sie dürfen nicht an versteckter Stelle in den Vertrag hineingemogelt werden (sonst sind sie als „überraschende Klauseln“ zu bewerten und werden nicht Vertragsbestandteil, § 305c Abs.1 BGB). Am besten werden Ausschlussklauseln unter einer Überschrift wie z.B. „Ausschlussfrist“ in den Vertrag aufgenommen.
- Ausschlussklauseln müssen für einen „durchschnittlichen“ Arbeitnehmer klar und verständlich sein (sonst sind sie nicht „transparent“ und haben aus diesem Grund keine Geltung, § 307 Abs.1 Satz 2 BGB).
- Ausschlussklauseln dürfen keine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers enthalten (sonst haben sie aus diesem Grund keine Geltung, § 307 Abs.1 Satz 1, Abs.2 BGB).
- Ausschlussklauseln dürfen nicht vorschreiben, dass die zur Fristwahrung erforderliche Leistungsaufforderung unbedingt schriftlich abgefasst werden muss, d.h. die Klausel muss klarstellen, dass eine fristwahrende Aufforderung zur Leistung auch in anderer Weise möglich ist, z.B. in Textform (Fax oder E-Mail). Diese Vorgabe gilt seit dem 01.10.2016 (wir berichteten in Arbeitsrecht aktuell: 16/254 Neuregelung zur Schriftform bei Ausschlussfristen).
Wann sind arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln überraschend und deshalb unwirksam? 
Wenn Sie als Arbeitgeber bei der Ausgestaltung von arbeitsvertraglichen AGB eine Ausschlussklausel an versteckter Stelle in den Arbeitsvertrag hineinmogeln, müssen Sie sich den Vorwurf gefallen lassen, dass die Ausschlussklausel „überraschend“ ist. Von einem normalen Arbeitnehmer kann man in einem solchen Fall nicht erwarten, dass er die Ausschlussklausel beim Durchlesen des Arbeitsvertrags entdeckt und richtig versteht. Dazu enthält § 305c Abs.1 BGB folgende Aussage:
„Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die nach den Umständen, insbesondere nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrags, so ungewöhnlich sind, dass der Vertragspartner des Verwenders mit ihnen nicht zu rechnen braucht, werden nicht Vertragsbestandteil.“
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat daher entschieden, dass Ausschlussklauseln nicht unter einer falschen oder missverständlichen Überschrift in den Arbeitsvertrag aufgenommen werden dürfen. Findet sich daher eine Ausschlussklausel am Ende des Vertrags unter der Überschrift „Schlussbestimmungen“ oder „Sonstiges“, ist sie als überraschende Klausel unwirksam (BAG, Urteil vom 31.08.2005, 5 AZR 545/04).
Wann sind arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln im Sinne des Arbeitnehmers auszulegen? 
Gemäß § 305c Abs.1 BGB gehen Zweifel bei der Auslegung von AGB zu Lasten des Arbeitgebers als des Klauselverwenders. In einem solchen Fall ist dann das dem Arbeitnehmer günstigere Verständnis der Klausel maßgeblich.
Auf der Grundlage dieser gesetzlichen Regelung ist die in Ausschlussklauseln oft verwendete Formulierung auszulegen, dass Ansprüche „gerichtlich geltend gemacht“ werden müssen. Das BAG versteht die „gerichtliche Geltendmachung“ zugunsten des Arbeitnehmers in einem weiten Sinne (BAG, Urteil vom 19.03.2008, 5 AZR 429/07). Danach genügt schon die Erhebung einer Kündigungsschutzklage als „gerichtliche Geltendmachung“ von Lohnansprüchen, die vom Ausgang der Kündigungsschutzklage abhängig sind.
BEISPIEL: In einem Arbeitsvertrag findet sich eine sog. zweistufige Ausschlussfrist. Danach sind auf einer ersten Stufe alle Ansprüche innerhalb von drei Monaten nach Fälligkeit gegenüber der Gegenpartei schriftlich geltend zu machen. Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder erklärt sich nicht, sind die Ansprüche auf einer zweiten Stufe innerhalb von drei Monaten nach der Ablehnung oder dem Fristablauf „gerichtlich geltend“ zu machen. Der Arbeitnehmer wird fristlos gekündigt und erhebt Kündigungsschutzklage. Damit hat er zwar noch nicht die Lohnansprüche für die Zeit nach Ausspruch der Kündigung eingeklagt, denn eine Kündigungsschutzklage ist keine Lohnklage. Allerdings will er mit seiner Kündigungsschutzklage erreichen, dass diese Lohnansprüche nicht mehr unter Hinweis auf die Kündigung bestritten werden können. Und das reicht für eine „gerichtliche Geltendmachung“, so das BAG.
Auf diese arbeitnehmerfreundliche Auslegung von „gerichtlicher Geltendmachung“ können sich auch Geschäftsführer berufen (BAG, Urteil vom 19.05.2010, 5 AZR 253/09 - wir berichteten in: Arbeitsrecht aktuell 10/202 Schutz vor unklaren Ausschlussklauseln). Eine Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit einer Geschäftsführerkündigung reicht dazu aus, um den Verfall der Gehaltsansprüche zu verhindern, die vom Ausgang dieser Bestandsstreitigkeit abhängig sind.
In ähnlicher Weise, d.h. im Sinne des Arbeitnehmers, versteht das BAG auch die Forderung einer arbeitsvertraglichen Ausschlussklausel nach einer „schriftlichen“ Geltendmachung von Ansprüchen. Hier genügt es, wenn der Arbeitnehmer den Arbeitnehmer per E-Mail zur Erfüllung der Ansprüche auffordert (BAG, Urteil vom 16.12.2009, 5 AZR 888/08 - wir berichteten in: Arbeitsrecht aktuell 10/090 Ausschlussfrist: Geltendmachung per E-Mail).
Wann sind arbeitsvertragliche Ausschlussfristen zu kurz und die Klausel daher wegen unangemessener Benachteiligung des Arbeitnehmers unwirksam? 
Wie oben erwähnt wirken sich Ausschlussklauseln in erster Linie zulasten der Arbeitnehmerseite aus. Und je kürzer die (dem Arbeitnehmer) durch eine Ausschlussklausel verbleibende Zeit für die Geltendmachung seiner Ansprüche ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Ansprüche (des Arbeitnehmers) infolge der Ausschlussfrist untergehen. Aus Arbeitgebersicht sollten arbeitsvertragliche Ausschlussfristen daher möglichst kurz sein.
An diesem Punkt kommt das gesetzliche Verbot einer unangemessenen Benachteiligung ins Spiel. Es ist in § 307 Abs.1 Satz 1 BGB festgelegt. Diese Vorschrift lautet:
„Bestimmungen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen.“
Unter Bezugnahme auf diese Vorschrift hat das BAG entschieden, dass es eine unangemessene Benachteiligung des Arbeitnehmers darstellt, wenn eine arbeitsvertragliche Ausschlussklausel eine Frist von weniger als drei Monaten für die erstmalige Geltendmachung von Ansprüchen vorsieht (BAG, Urteil vom 28.11.2007, 5 AZR 992/06).
Dürfen arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln die schriftliche Geltendmachung von Ansprüchen vorschreiben? 
Jahrzehntelang sahen fast alle arbeitsvertraglichen Ausschlussfristen vor, dass der Anspruchsberechtigte seinen Anspruch gegenüber der anderen Vertragspartei "schriftlich geltend machen" musste.
Eine solche Klausel ist irreführend, denn § 127 Abs.2 Satz 1 BGB sieht bei vertraglichen Schriftformvorgaben eine wesentliche Erleichterung vor. Danach muss man nicht zu Stift und Papier greifen, sondern es genügt die "telekommunikative Übermittlung", sprich eine E-Mail, eine SMS oder ein Fax.
Daher gilt für Arbeitsverträge, die am 01.10.2016 abgeschlossen oder aufgrund einer Änderung neu ausgefertigt werden, gemäß der Neufassung von § 309 Nr.13 b) BGB, dass Arbeitnehmern in arbeitsvertraglichen Ausschlussklauseln keine "strengere Form als die Textform" vorgeschrieben werden darf. Dieser Vorschrift zufolge ist in AGB unwirksam
"(Form von Anzeigen und Erklärungen)
eine Bestimmung, durch die Anzeigen oder Erklärungen, die dem Verwender oder einem Dritten gegenüber abzugeben sind, gebunden werden
a) an eine strengere Form als die schriftliche Form in einem Vertrag, für den durch Gesetz notarielle Beurkundung vorgeschrieben ist oder
b) an eine strengere Form als die Textform in anderen als den in Buchstabe a genannten Verträgen oder
c) an besondere Zugangserfordernisse;"
Damit ist die traditionell übliche Vorgabe, dass Ansprüche zur Wahrung einer vertraglichen Ausschlussfrist schriftlich geltend zu machen sind, nicht mehr zulässig bzw. unwirksam (wir berichteten in Arbeitsrecht aktuell: 16/254 Neuregelung zur Schriftform bei Ausschlussfristen).
Müssen arbeitsvertragliche Ausschlussklauseln Ansprüche des Arbeitnehmers auf Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns ausdrücklich von ihrem Anwendungsbereich ausnehmen? 
Ja, das ist der Fall. Andernfalls ist die gesamte Klausel unwirksam.
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat im September 2018 entschieden, dass formularvertragliche Ausschlussklauseln ohne eine solche ausdrückliche Klarstellung wegen Unklarheit insgesamt unwirksam sind (BAG, Urteil vom 18.09.2018, 9 AZR 162/18).
Einen kurzen Kommentar zu dieser Entscheidung finden Sie hier: Arbeitsrecht aktuell: 18/232 Ausschlussklauseln ohne Mindestlohn-Ausnahme sind unwirksam.
Müssen arbeitsvertragliche Ausschlussfristen Ersatzansprüche wegen vorsätzlicher Schädigung ausdrücklich ausklammern? 
Ja, das müssen sie. Andernfalls ist die gesamte Klausel unwirksam.
Denn gemäß § 202 Abs.1 BGB ist gesetzlich nämlich ausgeschlossen, per Vertrag eine Abkürzung der Verjährung zu vereinbaren, wenn davon (auch) Ansprüche aus vorsätzlicher Schädigung erfasst sind. Und da auch Ausschlussfristen zu einer Abkürzung der Verjährung führen, ist es gesetzlich ausgeschlossen, dass vertragliche Ausschlussfristen Ansprüche aus Vorsatzhaftung erfassen.
Darauf wiederum müssen Arbeitgeber als Klausel-Verwender in der Klausel ausdrücklich hinweisen. Das hat das BAG Ende 2020 entschieden und damit seine jahrelang anderslautende Rechtsprechung geändert (BAG, Urteil vom 26.11.2020, 8 AZR 58/20, s. dazu Update Arbeitsrecht 09|2021 vom 05.05.2021 BAG: Vertragliche Ausschlussklauseln müssen Ansprüche wegen Vorsatzhaftung ausnehmen).
Bleibt die erste Stufe einer Ausschlussfrist bestehen, auch wenn die zweite Stufe unwirksam ist? 
Einstufige Ausschlussfristen sehen vor, daß die Ansprüche bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Fälligkeit gegenüber der anderen Vertragspartei geltend gemacht werden müssen.
Zweistufige Ausschlussfristen bestimmen darüber hinaus, dass man nach der (schriftlichen) Geltendmachung seiner Forderung auf der „erste Stufe“ innerhalb einer weiteren Ausschlussfrist (d.h. auf einer „zweiten Stufe“) Klage beim Arbeitsgericht erheben muss, falls die Gegenseite die Leistung verweigert oder sich nicht dazu erklärt.
Wie eine einstufige Ausschlussfrist dem Arbeitnehmer mindestens drei Monate für die erstmalige Geltendmachung seiner Ansprüche gegenüber dem Arbeitgeber lassen muss, so muss auch eine zweistufige Ausschlussfrist dem Arbeitnehmer mindestens drei Monate für die Erhebung einer Klage lassen, d.h. für die Geltendmachung des Anspruchs auf der zweiten Stufe.
Ist die im Arbeitsvertrag vorgesehen Frist für die Erhebung der Klage („zweite Stufe“) zu kurz bemessen, bleibt nach der Rechtsprechung die für die erstmalige Geltendmachung vorgesehene Ausschlussfrist bestehen („erste Stufe“), da man beide Stufen klar voneinander trennen kann.
BEISPIEL: In einer arbeitsvertraglichen Ausschlussklausel ist vorgesehen, dass alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht spätestens drei Monate nach Fälligkeit schriftlich gegenüber der Gegenpartei geltend gemacht werden (erste Stufe). Für den Fall, dass die Gegenpartei den geltend gemachten Anspruch ablehnt oder sich zu ihm nicht binnen einer Frist von einem Monat erklärt, ist der Anspruch binnen eines weiteren Monats ab Ablehnung oder Fristablauf einzuklagen (zweite Stufe). Die Ausschlussfrist erster Stufe ist mit drei Monaten in Ordnung, die Ausschlussfrist zweiter Stufe dagegen mit ein bzw. zwei Monaten zu kurz und daher unwirksam.
In einem solchen Fall bleibt die Ausschlussfrist erster Stufe bestehen, da sie für sich genommen, d.h. auch bei Wegstreichen der Ausschlussfrist zweiter Stufe, eine für sich allein sinnvolle Regelung darstellt (BAG, Urteil vom 12.03.2008, 10 AZR 152/07; Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 16.01.2007, 9 Sa 1011/06 - wir berichteten in: Arbeitsrecht aktuell 07/13 LAG Köln stärkt zweistufige Ausschlussklauseln).
Wo finden Sie mehr zum Thema Arbeitsvertrag und allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - Ausschlussklausel? 
Weitere Informationen, die Sie im Zusammenhang mit dem Thema Arbeitsvertrag und allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - Ausschlussklausel interessieren könnten, finden Sie hier:
- Handbuch Arbeitsrecht: Arbeitsvertrag und allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
- Handbuch Arbeitsrecht: Ausschlussfrist
- Handbuch Arbeitsrecht: Urlaubsabgeltung
- Übersicht Handbuch Arbeitsrecht
Kommentare unseres Anwaltsteams zu aktuellen Fragen rund um das Thema Arbeitsvertrag und allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) - Ausschlussklausel finden Sie hier:
- Update Arbeitsrecht 23/2022 BAG: Vorrang der urlaubsrechtlichen Regelungen im Elternzeitrecht gegenüber dem Bundesurlaubsgesetz
- Update Arbeitsrecht 19|2022 LAG Baden-Württemberg: Auslegung tarifvertraglicher Ausschlussfristen
- Update Arbeitsrecht 09|2021 Vertragliche Ausschlussklauseln müssen Ansprüche wegen Vorsatzhaftung ausnehmen
- Arbeitsrecht aktuell: 20/109 Klage gegen Versetzung und Ausschlussfristen
- Arbeitsrecht aktuell: 18/276 Ausschlussfristen gelten nicht für Ersatzurlaub
- Arbeitsrecht aktuell: 18/232 Ausschlussklauseln ohne Mindestlohn-Ausnahme sind unwirksam
- Arbeitsrecht aktuell: 18/150 Hemmung einer arbeitsvertraglichen Ausschlussfrist durch Vergleichsverhandlungen
- Arbeitsrecht aktuell: 16/271 Ausschlussfristen und Mindestlohn
- Arbeitsrecht aktuell: 16/254 Neuregelung zur Schriftform bei Ausschlussfristen
- Arbeitsrecht aktuell: 16/092 Verfallsfrist gemäß TV-L wird durch Klage nicht gewahrt
- Arbeitsrecht aktuell: 14/378 Klage wahrt Ausschlussfrist gemäß 167 ZPO
- Arbeitsrecht aktuell: 14/131 Mindestlohn 2015
- Arbeitsrecht aktuell: 13/240 Betriebsübergang und Ausschlussfristen
- Arbeitsrecht aktuell: 13/181 Ausschlussklausel und Vorsatz
- Arbeitsrecht aktuell: 11/196 Ausschlussklausel in AGB wirkt gegen Arbeitgeber, auch wenn die Frist zu kurz ist
- Arbeitsrecht aktuell 11/158 Urlaubsabgeltung und Ausschlussfristen
- Arbeitsrecht aktuell: 10/222 Lohn aus abgerechneten Zeitguthaben verfällt nicht aufgrund tariflicher Ausschlussfrist
- Arbeitsrecht aktuell 10/202 Schutz vor unklaren Ausschlussklauseln
- Arbeitsrecht aktuell 10/090 Ausschlussfrist: Geltendmachung per E-Mail
- Arbeitsrecht aktuell 07/13 LAG Köln stärkt zweistufige Ausschlussklauseln
- Arbeitsrecht aktuell 02/01 Schuldrechtsreform und Arbeitsrecht
Letzte Überarbeitung: 25. November 2022
Was können wir für Sie tun? 

Wenn Sie als Arbeitgeber arbeitsvertragliche Vertragsmuster mit Ausschlussklauseln rechtssicher gestalten oder vorhandene Verträge zunächst nur überprüfen oder aktualisieren lassen wollen, beraten wir Sie jederzeit gerne. Möglicherweise haben Sie auch vertragsrechtliche Fragen, wenn man Ihnen als Arbeitnehmer oder Geschäftsführer vorformulierte Ausschlussklauseln zur Unterschrift vorlegt. Auch diese Fragen klären wir gerne für Sie, falls nötig auch kurzfristig. Wir gestalten und überprüfen nicht nur Arbeitsverträge, sondern auch ergänzende vertragliche Vereinbarungen wie z.B. Arbeitnehmerdarlehensverträge, Dienstwagenregelungen, Provisionsregelungen, Rückzahlungsvereinbarungen oder Zielvereinbarungen. Je nach Lage des Falles und entsprechend Ihren Vorgaben beraten wir Sie nur intern oder verhandeln in Ihrem Namen mit Ihrem Vertragspartner. Für eine möglichst rasche und effektive Beratung benötigen wir folgende Unterlagen:
|
Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gern:
 |
Dr. Martin Hensche Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hensche@hensche.de |
 |
Christoph Hildebrandt Rechtsanwalt Fachanwalt für Arbeitsrecht Kontakt: 030 / 26 39 620 hildebrandt@hensche.de |
 |
Nina Wesemann Rechtsanwältin Fachanwältin für Arbeitsrecht Kontakt: 040 / 69 20 68 04 wesemann@hensche.de |
HINWEIS: Sämtliche Texte dieser Internetpräsenz mit Ausnahme der Gesetzestexte und Gerichtsentscheidungen sind urheberrechtlich geschützt. Urheber im Sinne des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Martin Hensche, Lützowstraße 32, 10785 Berlin.
Wörtliche oder sinngemäße Zitate sind nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Urhebers bzw.
bei ausdrücklichem Hinweis auf die fremde Urheberschaft (Quellenangabe iSv. § 63 UrhG) rechtlich zulässig.
Verstöße hiergegen werden gerichtlich verfolgt.
© 1997 - 2026:
Rechtsanwalt Dr. Martin Hensche, Berlin
Fachanwalt für Arbeitsrecht
Lützowstraße 32, 10785 Berlin
Telefon: 030 - 26 39 62 0
Telefax: 030 - 26 39 62 499
E-mail: hensche@hensche.de













 Autorenprofil
Autorenprofil